Stadtteilzeitung
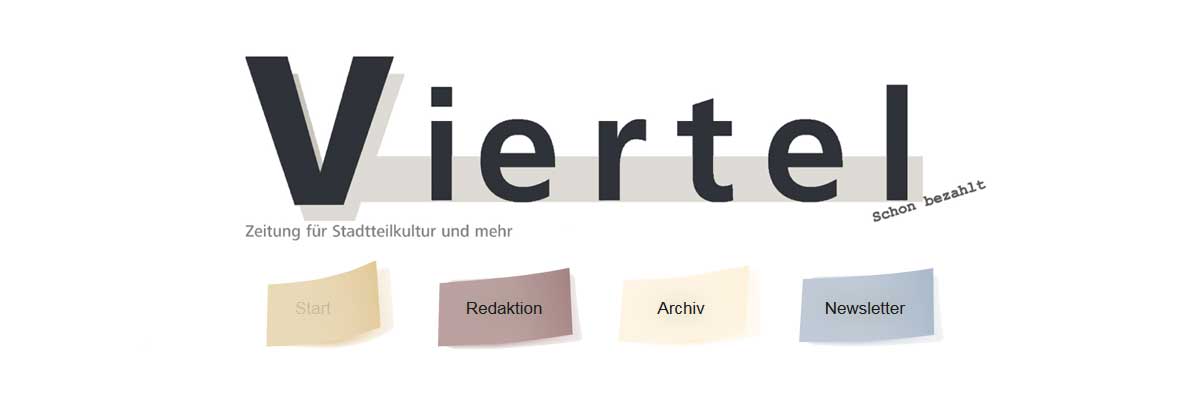
Im Juni 2006 erschien die erste Ausgabe der ›Viertel – Zeitung für Stadtteilkultur und mehr‹. Seither gibt es drei Ausgaben im Jahr mit Themen für und aus dem Bielefelder Westen. Die Zeitung wird von einer ehrenamtlichen und unabhängigen Redaktion herausgegeben. Sie greift Anregungen und Kritik, Hinweise auf beispielhafte Projekte oder außergewöhnliche Begebenheiten gern auf.
Kontakt:
Viertel - Zeitung für Stadtteilkultur und mehr
c/o BI Bürgerwache e.V.
Rolandstr. 16
33615 Bielefeld
post@die-viertel.de
Warum ehrenamtlich?
Seit Jahren sind die Honorare so gering, dass die meisten freien Journalist*innen nur vom Schreiben leben können, indem sie jedes Thema bis zu sieben Mal verkaufen. Kolleg*innen berichten, dass diese Akquisen über die Hälfte ihrer Arbeitszeit einnehmen. Ich möchte Zeit lieber in Inhalte investieren, darum habe ich einige Jahre ehrenamtlich für die Viertel geschrieben und konnte meinen Ursprungsberuf auf diese Weise, wenn auch unentgeltlich, weiter pflegen.
Bedenklich und belastet
(Viertel #42 / 2020) Das Museum Huelsmann hat die Herkunft seiner Objekte erforscht und NS-Raubkunst gefunden. Von Aiga Kornemann
»Don't mention the war«, hieß es bis in die 1990er Jahre hinein im europäischen Kunstmarkt. Bis heute gibt es keine seriöse Zahl, wie viele Kulturgüter der jüdischen Bevölkerung in Deutschland zwischen 1933 und 1945 »entzogen« oder gestohlen wurden. Kunst, Kunsthandwerk und historisch wertvolle Bücher gelangten in Museen oder schlummern bei privaten Sammlern im In- und Ausland. Herkunftsnachweise wurden umformuliert, Unterlagen über Weiterverkäufe noch Jahrzehnte später vernichtet.
So wundert es nicht, dass die Provenienzforscherin Dr. Brigitte Reimann auch für die Sammlung Huelsmann weder Geschäftsunterlagen noch ein Sammlungsinventar aus der Zeit des NS-Regimes vorfand. Drei Jahre lang hat sie die Herkunft der knapp 1.000 Objekte im Bielefelder Museum Huelsmann kritisch untersucht und für 200 davon Herkunftshinweise gefunden. 40 sind aufgeklärt und als »unbedenklich« eingestuft. »Für 160 besteht weiterer Forschungsbedarf«, sagt Reimann. Neun Objekte dieser 160 stammen aus fragwürdiger Herkunft. NS-Raubkunst sind möglicherweise zwei Altarleuchter, die dem jüdischen Unternehmer Harry Fuld jr. gehörten. 1937 von der Gestapo beschlagnahmt, wurden sie 1943 in Berlin versteigert und verschwanden von der Bildfläche. Hülsmann erwarb sie 1968 von einem bayerischen Kunsthändler, der sich als NSDAP-Mitglied maßgeblich für die »Arisierung« der Kunstverbände im NS stark gemacht und sein Geschäft 1949 wieder aufgenommen hatte.
Für beide Leuchter gibt es eine Suchmeldung in der Lost Art Datenbank, die Anfragen nach NS-Raubkunst bündelt. Gleichzeitig gibt es Hinweise, dass Fuld die Leuchter nach dem Krieg zurückerhielt und seine Erben sie selbst 1968 in die Auktion einbrachten. Dann wäre die Provenienz unbedenklich. Auch sechs kleine Trinkschalen und eine Bernstein-Schale sind bei Lost Art verzeichnet. Wahrscheinlich hat sie ein Mitarbeiter des Schlossmuseums Gotha im Chaos nach Kriegsende widerrechtlich im Namen des Museums an eine Erfurter Kunsthandlung verkauft. Friedrich Hülsmann erstand sie in den 1960er Jahren.
Auf Exklusivität bedacht
»Hülsmanns waren intellektuell, liberal, auch ehrgeizig«, hat die Provenienzforscherin herausgefunden. Vom Mainstream hätten sie sich ferngehalten, immer auf Exklusivität geachtet. »Aber natürlich ist es erst mal verdächtig, wenn jemand 1938 in Hamburg eine Kunsthandlung eröffnet.« In den 30ern erlebte der Handel mit Kunst einen riesigen Aufschwung. In den wenigen erhaltenen Aufzeichnungen über »Juden-Auktionen«, auf denen allein in Hamburg der Besitz 30.000 jüdischer Haushalte verschleudert wurde, findet sich der Name Hülsmann nicht. Allerdings war das Ehepaar in Hamburg gut vernetzt, zum Beispiel mit Museen, die den geraubten Bestand vor diesen Auktionen auf ihren musealen Wert schätzten. Ob und wie genau Hülsmanns Kunsthandel von diesen Verbindungen profitierte, bleibt im Dunkeln.
Belegbare Informationen zur Geschichte des Ehepaars Hülsmann und seiner Kunsthandlung hat Brigitte Reimann aus privaten Dokumenten ziehen können, die das Museum als Schenkung erhielt, sowie aus dem fotografischen Nachlass Friedrich Hülsmanns, 3.600 Aufnahmen, die den Alltag in der frühen NS-Zeit dokumentieren. Die Ergebnisse des Provenienzprojekts hat das Museum Huelsmann in einem Parcours durch alle Räume in die Sammlung eingearbeitet und bietet Führungen, Vorträge sowie Begleitmaterial zum Thema.
Info: ![]() museumhuelsmann.de
museumhuelsmann.de
Zweite Heimat Bielefeld

(Viertel #38 / 2018, Foto: Martin Speckmann) Malek Khaleel brauchte Hilfe. Heute ist er Sozialarbeiter und hilft anderen. Aufgezeichnet von Charlotte Weitekemper und Aiga Kornemann
Der letzte Blick zurück war eine Katastrophe. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das auf Krücken schaffe so allein, bis nach Deutschland. Ich war noch nie so weit von zu Hause weg. Und ich habe meine Eltern im Krieg zurückgelassen. Ich kam Ende 2012 auf Einladung eines syrisch-deutschen Vereins nach Deutschland. Da gibt es Ärzte, die humanitäre Hilfe leisten. Ich habe ihnen meine Krankengeschichte geschickt. Ich war nur zu Fuß auf dem Heimweg gewesen. In der Woche hat die Assad-Armee in unserer Stadt alle Häuser nach Menschen durchsucht, die auf der Straße protestiert haben. Dann schien die Armee weg zu sein und meine Mutter sagte, ich soll dem Nachbarn Essen bringen. Auf dem Rückweg kam ein Panzer. Er hat sofort geschossen, nur weil ich auf der Straße lief. An dem Tag sind 37 Leute bei uns auf der Straße erschossen worden. Drei habe ich im Krankenhaus erlebt, die sind da vor meinen Augen gestorben.
Eine Chance, in Damaskus operiert zu werden, hatte ich nicht. Ich war acht Monate mit Krücken unterwegs und dachte, na gut, dann bleibt das jetzt wohl so. Und dann klingelt das Telefon und jemand sagt, dass er ein Krankenhaus für mich gefunden hat, das Franziskus-Hospital in Bielefeld. Der Chefarzt damals, das ist der netteste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Meine Hüfte war total entzündet. Nach Wochen konnten sie erst die eigentliche OP machen. In dieser Zeit kam auch eine deutsche Familie zu mir, half mir, wenn ich etwas brauchte. Bei meinen deutschen Eltern wohne ich bis heute. Es war so ein Fest, nach über einem Jahr wieder ein bisschen laufen zu können!
»Jeder gegen jeden«
Anfangs war mir nicht klar, dass ich nicht mehr nach Hause zurück kann. Wir sind von drei Monaten ausgegangen. Daraus sind fünf Jahre geworden. In Syrien kämpft jetzt jeder gegen jeden und jeder sagt, er hat recht. Nur die Menschen, die dort leben, haben keine Rechte mehr. Meine Eltern sind allein in Syrien, meine fünf Geschwister sind in der Türkei und Dubai. Mein Vater war als Bauingenieur zwölf Jahre in Dubai, kam nur im Sommer für vier Wochen nach Hause. Sonst hätten wir nicht alle studieren können und das war besonders meiner Mutter wichtig. Sie durfte es nicht, mein Opa war dagegen. Meine Mutter hat in ihrem Leben richtig viel für uns getan. Manchmal war sie bis drei Uhr wach, wenn wir gelernt haben. Sie war so glücklich, als sie gehört hat, dass ich hier nochmal studieren kann. Ich habe ihr erklärt, ich helfe Leuten. Da sagt sie, aber das tust du doch, warum sollst du das studieren?
In Syrien habe ich als Grundschullehrer gearbeitet. Hier im Sprachkurs wurden wir zu Ausbildungen und Arbeit in Deutschland beraten. Sie haben über Sozialarbeit gesprochen und ich habe mich sofort in dieses Fach verliebt, bis heute. Ich hab das Sprachniveau geschafft und meine Zulassung gekriegt für die Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld. Im Studium habe ich gelernt, dass Sozialarbeit eigentlich nach den Weltkriegen in Deutschland entstand. Das war eine extra Motivation. Dass hier Sozialarbeiter gebraucht werden, die sich auskennen mit der Sprache und der Kultur der Menschen, die hier Unterstützung suchen. Dass aber auch in Syrien nach dem Krieg Sozialarbeiter gebraucht werden.
»So viele Buchstaben«
Aber erst mal deutsch lernen. Ich kannte Dortmund, wegen Borussia, ein paar Automarken, das war's. Ich kannte auch den Klang der Sprache nicht. Merkwürdig finde ich zum Beispiel das Wort »Entschuldigung«. Wenn einem etwas leid tut, denkt man doch an ein leichtes Wort, sowas wie »Sorry«. Wenn ich »Entschuldigung« höre, denke ich, jemand kämpft mit mir, so viele Buchstaben. Und die Umlaute sind ein großes Thema, wir haben sowas nicht. Zum Beispiel »Eichhörnchen«. Werde ich im Leben nicht sagen können. Das arabische Wort dafür ist klein und schön, wie das Tier.
Nein, ich wusste gar nichts, als ich nach Deutschland kam. Ich wusste nicht, dass Händler nicht mogeln, oder die Sache mit der Zeit. Zum Beispiel war ich heute, kein Araber würde das tun, für dieses Gespräch pünktlich um vier Uhr am vereinbarten Ort. Bei uns heißt es, wir treffen uns nachmittags, also irgendwann zwischen zwei und vier. Aber hier ist 16 Uhr 16 Uhr. Mir gefällt das inzwischen. Als ich meiner Mutter das erzählt habe, hat sie herzlich gelacht. Manchmal ist es eben schwierig zu erklären, wie anders hier alles ist.
Info › Malek Khaleel stammt ursprünglich aus Idleb/Syrien. Er studierte Geistes- und Humanwissenschaft an der Aleppo Universität und war bis zu seiner Übersiedlung nach Deutschland 2012 Grundschullehrer in Idleb. Es folgten ehrenamtliche Tätigkeiten im Flüchtlingsheim und in der Betreuung von Flüchtlingsfamilien sowie unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Bielefeld. Malek Khaleel hat Soziale Arbeit und Management an der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld studiert und ist als Sozialarbeiter im Jugendwerk Rietberg tätig.
Krähe und Bär
(Viertel #36 / 2018) ... Oder die Sonne scheint für uns alle. Für Martin Baltscheits Kinderhörspiel schwärmt Aiga Kornemann
Ein Braunbär im Budapester Zoo vernimmt Gezappel im Teich seines Geheges. Er findet eine Krähe, die sich Flügel schlagend über Wasser halten, aber nicht daraus befreien kann. Der Bär greift zu und nimmt eine Flügelspitze zwischen die Zähne. Zart hebt er den Vogel aus seiner misslichen Lage und spuckt ihn aufs trockene Land. Die Krähe stellt sich kurz mal tot, man weiß ja nie. Der Bär beachtet sie nicht weiter. Ein Zoobesucher hat die Szene auf youtube eingestellt.
Der Autor und Illustrator Martin Baltscheit hat aus ›Krähe und Bär‹ ein Kinderbuch gemacht. Seine Theaterfassung erhielt 2016 den Deutschen Kindertheaterpreis. Im März 2018 folgte der Kinderhörspielpreis des MDR Rundfunkrates für die Hörspielversion unter Baltscheits Regie. Das Hörspiel spreche große Menschheitsfragen nach Freiheit, Lebenssinn und Freundschaft an, befand die Jury. Außerdem sei es spannend umgesetzt mit toller Musik und tollen Sprechern.
Lina Beckmann und Charly Hübner sind Krähe und Bär. Vorm inneren Auge sind sie es wirklich, in jeder Sekunde. Die Krähe ist frei. Was sie nicht so toll findet, denn sie hat ständig Hunger. Ist doch viel schöner, wenn sich jemand kümmert, oder? Krähe hat sich positives Denken antrainiert, selbst ihrer jüngsten Erfahrung der Todesnähe gewinnt sie Gutes ab. Doch Bär gibt sich zunächst, je nun, brummig. Im Käfig geboren hat er nichts von der Welt gesehen, jeder Spaziergang ist nach sieben Schritten zu Ende: »Licht am Ende des Käfigs, was für eine Krähenscheiße.«
Mit Lina Beckmann und Charly Hübner
Krähe schleppt Requisiten an, irgendwie muss sich der Bursche doch auflockern lassen. Die Erdmännchen sagen, der Bär sei das dümmste Tier und komme nicht ins Paradies, weil er an nichts glaubt. Das glaubt die Krähe nicht, und der Bär, der verplappert sich im Schlaf, er findet die Krähe nämlich nicht so doof, wie er tut. Die beiden kommen sich nah, finden sogar einen Weg, in die Haut des anderen zu schlüpfen. Mit Geschichtenzauber geht sowas.
Märchen können alles, hat Baltscheit mal in einem Interview gesagt: »Sie können schockieren und eiskalt sein, aber sie gehen immer gut aus. Das ist wichtig. Man darf Kinder nicht mit einem Fragezeichen zurücklassen.« Das Hörspiel ›Krähe und Bär oder Die Sonne scheint für uns alle‹ lässt wohl die meisten Kinder und Erwachsenen höchst inspiriert zurück. Das liegt nicht nur am tiefgründigen Austausch in deftigem Wortgewand, sondern auch an der wunderschönen Umsetzung der wendungsreichen Fabel. Baltscheit hat auf einen Erzähler verzichtet, der Dialog zweier Zoowärter übernimmt, wo nötig, moderierende Funktion. Die Soundkulisse bleibt im Hintergrund. Auch das Sounddesign passt, spielt nichts künstlich hoch. Die Musiken stammen von der namhaften Jazzkomponistin und Saxophonistin Sandra Weckert.
Menschen anzustiften, etwas Kreatives, Lustiges oder Nachdenkliches zu tun, sei ein gutes Gefühl, beschreibt Martin Baltscheit die Motivation für sein Schaffen. Mission accomplished!
Info › Martin Baltscheit, Krähe und Bär oder Die Sonne scheint für uns alle, 2016 erschienen bei Oetinger audio
Alles im Flow

(Viertel #35 / 2017, Screenshot: Dragon Age Inquisition, Bioware 2014) Computerrollenspiele können begehbare Kinofilme, Zweitwohnsitz der Fantasie und elende Zeitfresser sein. Einmal das ganze Gedeck bestellte Aiga Kornemann
Nichts als Wüste, ein Sandmeer im Licht zweier Monde. Die Hand eines Riesen hat Findlinge in die Ebene gewürfelt. Zwischen ihnen glimmt ein Lagerfeuer. Ein Mann in lederner Rüstung hockt an der Glut. Schnarchen grollt aus einem mannsgroßen Bündel Decken nahebei. Dem Wachenden fallen die Augen zu, sein Kinn sinkt auf die Brust. Plötzlich sticht ein Käckern in die Stille. Der Mann fährt hoch, greift zu Bogen und Köcher und huscht in den Schatten eines Felsens. Auch sein Gefährte ist aufgeschreckt, steht schon mit gezückter Waffe hinter ihm, legt den Zeigefinger an die Lippen. Der Bogenschütze nickt.
Die Riesenspinnen müssen schnell, ohne sich von ihrer ätzenden Spucke treffen zu lassen, gemetzelt werden, sonst stirbt der Held und die Geschichte geht nicht weiter. Der Bogenschütze wird vom Spieler gelenkt, der Gefährte führt als Bestandteil des Spiels ein Eigenleben, wird Freund oder Feind, je nachdem, wie ihm Held oder Heldin begegnen.
»Es gibt nichts, was ein Buch als Nährboden der Fantasie ersetzen könnte«, hat Astrid Lindgren gesagt, und für ihre Zeit mag der Satz gegolten haben. Heute beflügeln auch Computerrollenspiele die Fantasie, die Spielern ermöglichen, sich in einer filmreifen virtuellen Welt für eine Rolle, ein Geschlecht, eine Ethnie oder Spezies abseits eigener Lebenserfahrung zu entscheiden. Der/die Held*in wird im Verlauf unterschiedlich komplexer Geschichten durch die Entscheidungen des Spielers zur Charmeoffensive, kann aber auch als mitleidloser Vollpfosten agieren. Den nötigen Rechner oder die Spielkonsole zu bedienen und mit Unaussprechlichem wie Graka, Framework, Direct X, DLC und DRM jonglieren zu können, drückt Spielfremden den Stempel auf, von vorgestern zu sein. Die wehren sich mit Vorurteilen.
Nährboden der Fantasie
Wer Computerspiele spielt, stamme aus einem sozioökonomisch abgehängten Umfeld, sei männlich, jung, tendenziell spielsüchtig und gewalttätig, töte seine Fantasie und verschwende seine Zeit, glaubt Umfragen zufolge eine Mehrheit in diesem Land. Wissenschaftlich ist nichts davon haltbar, aber wen schert das schon. Die Spezies moderner Mensch teilt sich in Digital Natives, Digital Immigrants und Digital Dinosaurs. Erstere sind nach 1980 geboren und besitzen spätestens im Alter von zehn Jahren ein internetfähiges Handsprechgerät. Sie streamen, chatten und zocken schon eifrig, während Digital Immigrants, die vor 1980 Geborenen, noch googeln, was das heißt. Auch digitale Dinosaurier finden sich in allen sozialen Schichten und Altersgruppen. Ihr Widerstand gegen die unüberschaubare Flut von Medien und Technologien ist Verspannungen um Stirn und Mund abzulesen, die beim bloßen Gedanken an Computer schon ihre Gesichter verhärten, als zwinge man sie mit der Nase voran in eine Schüssel Haferschleim.
»Repräsentationen von Gewalt haben sich als Element der populären Literatur, des Films und Fernsehens und natürlich verschiedener nicht computergestützter Spielformate erhalten – ganz zu schweigen von Hunderten Jahren Geschichte der bildenden Künste, in deren Kontexten die Darstellung von Gewalt ein wichtiger Bestandteil ästhetischer Erfahrung war und ist«, sagt Christoph Bareither, Medienanthropologe der Humboldt-Universität Berlin. Gewalt in Computerspielen sei aus dieser Perspektive nicht mehr und nicht weniger als die konsequente Fortsetzung einer langen Tradition.
Kein Ausweg in Sicht. Der Golem nimmt einen losen Felsbrocken auf, lässt ihn am langen Arm baumeln, als teste er eine Bowlingkugel. Gut zwanzig Meter vom verriegelten Portal entfernt bringt er sich in Position, schwingt den Findling und lässt ihn schnurgerade aufs Hindernis fliegen. »Bämm!« Die Spielerin jubelt. Das Donnern, mit dem das Portal zerbirst, füllt ihre Ohren und den Raum dazwischen, strömt in den Körper hinab, kribbelt bis in die Zehen. Gemächlich glättet sich ihre Gänsehaut im Rumpeln fallenden Gerölls. Atmen. Der Steinriese stampft mit dem Fuß auf, lässt Staub wabern und die Fäuste gegen einander krachen. Ein Dutzend schwer bewaffneter Krieger stürmt ihm brüllend entgegen.
Der Spaß an virtueller Gewalt
Warum Spieler virtuelle Gewalt so vergnüglich finden – diese Frage hat Bareither versucht, für seine Dissertation zu ergründen, und hat dafür Hunderte Computerspieler beobachtet. Sein Fazit: Computerspielgewalt sei ein »körperlich-virtueller« und komplexer Spaß. Manche Spieler*innen empfinden die Kampfchoreografien als ästhetisch wohltuend, andere genießen Angst und Stress in Horror-Games, reizen Tabus aus, retten die »Guten«, üben Rache an den »Bösen«, betrauern verlorene virtuelle Freunde oder nehmen die Gewalt zum Anlass für kritische Reflexion – alles in der Gewissheit, sich in einem virtuellen Rahmen zu bewegen, in dem Regeln gelten, die nicht aufs »Real Life« übertragbar sind. Rahmungskompetenz nennt sich das.
In der realen Welt misst die Medienforschung dasselbe kurzfristige Ansteigen des Aggressionspegels bei Spielern, die keine gewaltsamen Inhalte zocken. Der Kamm schwillt beim Scheitern an der Mechanik, wenn die Tasten nicht so wollen, wie sie sollen. Selbst exzessives, suchtähnliches »Ballern« sei nicht durchs Spiel begründet, sondern ein Symptom für Schwierigkeiten anderswo: Soziale Ängste, Chancenlosigkeit, Einsamkeit und Ausgrenzung, frühe Erfahrungen körperlicher und seelischer Grausamkeit. Im Spiel stillt das gepeinigte Individuum seine Sehnsucht nach lösbaren Aufgaben, Anschluss und Erfolg.
Ezio muss über die Haftkraft eines Geckos verfügen. Fast schwerelos erklimmt er die Turmspitze, tastet sich über ein schmales Sims zu einem Balken vor, auf dem er schwer atmend verharrt. Greifvögel umkreisen ihn. Der Assassine schaut nach unten. Zig Meter tiefer wartet ein mit Stroh gefüllter Karren. Dem Spieler wird schwindelig, er weiß, was kommt. Morgensonne streicht die Dächer rosa. Ins Runde fahrend gibt die Kamera den Blick auf das Rom des 15. Jahrhunderts frei. »Atemberaubend«, japst der Spieler. Ezio lächelt, kommt mühelos aus den Knien in den Stand, tänzelt zwei Schritte nach vorn, hebt die Arme und lässt sich kopfüber fallen.
Teamwork statt Meisterkult
Nachdem sie inzwischen rund 50 Prozent Spielerinnen für sich entdeckt hat, stürzt sich die Industrie auf »Silver Gamer“ als neue Klientel. Ein Viertel der 34 Millionen Spielenden in Deutschland ist über 50 Jahre alt. Die Zeit schreit nach besseren Geschichten, tieferen Themen und weniger vorhersagbaren Spielmechaniken. Darum wird das neue Assassin's Creed neben gewohntem Hauen und Stechen einen Modus ohne Gegner und Kämpfe bieten, dafür mit zusätzlichen historischen Informationen für eine virtuelle Studienreise durchs alte Ägypten. Den »Touri-Modus« nennen das die Gamer.
Menschen aller Bildungsgrade und gesellschaftlichen Schichten spielen virtuelle Spiele. An einem großen Rollenspiel-Titel arbeiten um die 300 Leute über mehrere Jahre: Game Designer, Grafiker für die Charaktere, die Spielwelt, die Optik der Benutzerebene, Fachleute für Licht und Farben, Storyentwickler, Texter, Komponisten, Musiker, Sounddesigner und Schauspieler, die Spielindustrie zieht kreative Gewerke magisch an. Teamwork statt Meisterkult – vielleicht macht auch das die narrativen Computerspiele zum Schmuddelkind der Hochkultur.
Die Entwicklung des bisher teuersten Spiels, des Shooters ›Destiny‹, soll 500 Millionen Dollar gekostet haben. Hollywood-Produzenten werden blass. Innovative Impulse kommen trotzdem eher von unabhängigen Spielentwicklern, denen weit weniger Geld und Personal zur Verfügung steht. Genau wie die Großen tüfteln sie am »Flow«, dem emotional und körperlich spürbaren Sog, der Spieler ganz in ihrem Tun aufgehen lässt. Die sind recht unterschiedlich motiviert. Der am häufigsten genannte Grund zu spielen, ist schlicht: Langeweile. Außerdem wollen Gamer mit surrealen Elementen spielen, Teil einer spannenden Geschichte sein, Welten erforschen. Viele lieben es, Dinge aufzustöbern und zu sammeln, oder Hindernisse strategisch anzugehen. Das perfekte Spiel gibt es nicht, dafür sind die Interessen, technischen Voraussetzungen und Fertigkeiten der Spieler viel zu unterschiedlich. Ausprobieren, Freunde um Tipps bitten – und dann der Realität entwischen, wenigstens für ein paar Stunden. Bämm!